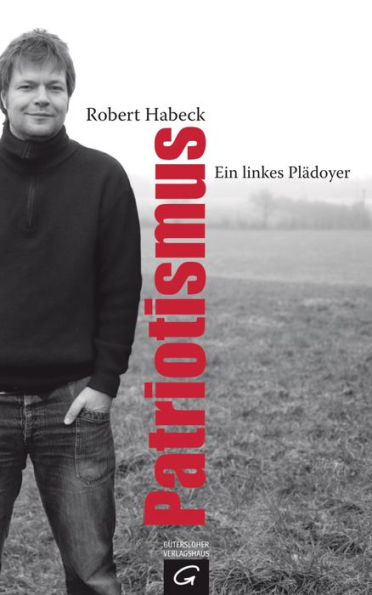Overview

Product Details
| ISBN-13: | 9783641042882 |
|---|---|
| Publisher: | Gütersloher Verlagshaus |
| Publication date: | 06/23/2010 |
| Sold by: | Bookwire |
| Format: | eBook |
| Pages: | 200 |
| Sales rank: | 504,884 |
| File size: | 314 KB |
| Language: | German |
About the Author
Read an Excerpt
Ohne Netz
Als ich das erste Mal neben Joschka Fischer stand, passierte etwas Merkwürdiges. Es war auf einem Bundesparteitag in der Messehalle in Hannover, viele Kameras, die Halle flimmerte in grellgrünem Licht, eine nervöse Anspannung war zu spüren, die Grünen steckten mitten in der zweiten Legislatur der rot-grünen Regierung und alle waren sie da, Renate Künast, Jürgen Trittin, Claudia Roth, Daniel Cohn-Bendit. Ich stand im Mittelgang, ein Mann schob sich an mir vorbei mit den Worten, »Kann ich mal?«, kleiner als im Fernsehen, mit krummem Gang. Heute muss ich bei dem Gedanken, dass Joschka Fischer mich fragte, ob er mal könne, lachen und mir fallen diverse Wortspiele ein. In dem Moment aber hatte ich ein merkwürdiges Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit. Es war, als würde ich einen Film sehen, in dem ich gleichzeitig mitspielte, ungefähr so, wie Jim Carry in dem Film »Die Truman-Show«, als er plötzlich erkennt, dass ein Obdachloser sein Vater ist. Und dieses Gefühl habe ich noch heute.
2002 trat ich in die Grünen ein, 2004 wurde ich Landesvorsitzender. Das war im November 2004, kurz vor der Landtagswahl. Direkt nach meiner Wahl wurde eine Kommission gewählt, die die Koalitions-Verhandlungen mit der SPD führen sollte. Und »die Basis« forderte vehement, dass nicht nur »Funktionäre« in dieser Kommission saßen. Das ging auch gegen mich. Eben noch war ich Basis und Neumitglied, 20 Minuten später Apparatschik. Dabei hatte ich mich doch gar nicht verändert, hatte mich die Macht noch nicht korrumpiert. Aber so ist es dauernd. Wir wählen Menschen als Hoffnungsträger in Ämter und verlieren, kaum dass sie einen Titel haben, die Hoffnung, dass sie es besser machen. Nicht zwingend, weil die Menschen uns enttäuschen. Auch, weil »wir« zu schnell bereit sind zu glauben, dass eine Funktion einen Menschen verändert. Visionen zu haben und zu behalten, bedeutet aber, nicht autoritätshörig zu sein. Und das gilt für beide Seiten. Beide Seiten? Welche Seiten denn? Hier das Volk und da die Politiker? Ein Widerspruch. Es gibt wohl keinen Menschen, der in eine Partei eintritt oder sich politisch engagiert, weil er alles gut findet, wie es ist. Sich einbringen, Dinge verändern, es anders machen zu wollen, zeigen, dass es anders geht, deshalb tritt man in eine Partei ein - und schwupps ist man ein Politiker und gehört zu »denen«. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, als solcher angesprochen zu werden. Politiker? Das sind doch die anderen, die alten Männer mit den dicken Bäuchen, die Schnösel mit den Nadelstreifenanzügen, die man immer verachtet hat. Politik, das ist Uneigentlichkeit und Zynismus. Aber selbst wenn doch Gelderwerb und Ruhmsucht die Antriebsfedern für politisches Engagement sein sollten - die Frage ist gar nicht, ob das stimmt und was ich bin, sondern was diese Haltung bedeutet.
Um Politiker zu werden, braucht man keine Ausbildung, noch nicht mal Fachwissen, eher Qualitäten wie Kommunikationsgeschick, Auffassungsgabe, Redetalent - lauter Dinge, die man als »training on job« nirgendwo als in der Politik erwerben kann. (Und manche, die sich Politiker nennen, haben noch nicht mal das gelernt.) Das erklärt besser als irgendwelche Karrieregeilheit-Vorwürfe, warum so viele Funktionsträger im System Politik aufsteigen und ein Quereinstieg so selten gelingt. Politiker zu sein lernt man am besten und eigentlich nur in der Politik. (Nur wenn man Schriftsteller ist und darin geübt, Romanfiguren nicht nur daraufhin zu überprüfen, was sie tun, sondern auch warum sie es tun, wenn man Shakespeares Dramen kennt, dann bringt man einiges an Rüstzeug bereits mit.) Die Geschlossenheit des politischen Systems ist so offensichtlich, wie es die Grundintention der Demokratie in Frage stellt: Die Lösungen, die die politischen Parteien anbieten, sind Lösungen, die aus den selbstbezüglichen Strukturen des Politiksystems kommen. Das ist erklärlich, aber fatal. Es gebiert eine gewisse Feigheit, neue Ansätze zu wagen, es führt zur Fortsetzung der eingeübten Rituale, es befördert ein Denken in Problemlagen, nicht in Lösungen.
»Warum haben Politiker keine Visionen mehr?« wurde ich im Sommer 2009 in einem Zeitungsinterview gefragt. Ich hatte damals keine gute Antwort. Ich konnte nur eine Widersprüchlichkeit beschreiben. Ja, es ist richtig, Weltverbesserer sind gefragt und wären nötig. Aber man muss sie mit der Lupe suchen. Woran liegt das? Werden immer die Falschen gewählt? Gibt es keine Obamas, Robin Hoods, Willy Brandts mehr in Deutschland? Wieso ist der Ruf nach Visionen und Visionären so laut und dennoch unerhört? Nun, heute antworte ich: Weil er nicht ehrlich ist. Denn Visionen auch umgesetzt sehen zu wollen, setzt voraus, dass man Veränderung will. Das Wahlverhalten in Deutschland widerspricht aber dem angeblich so starken Verlangen nach Visionen diametral. Die meisten Menschen scheinen zu wollen, dass alles so bleibt, wie es ist (oder früher war, auch wenn die Erinnerung da oft trügen mag Gewählt werden die, die versprechen, dass sie Veränderungen zurücknehmen. Das ist kein spezifisch deutsches Phänomen, sondern eine alte abendländische Denkfigur. Seit der Vertreibung aus dem Paradies glauben die Menschen, dass das Beste bereits hinter uns liegt, dass das »Goldene Zeitalter« nur in der Wiederholung des Vergangenen bestehen kann, sind Utopien immer regressiv. Selbst der Marxismus hoffte, dass im Endstadium die arbeitsteilige Gesellschaft wieder überwunden werden würde. Visionen und Visionäre sollen also dafür sorgen, dass alles wieder so wird, wie es früher war. Das Dumme ist nur, dass dieses »Früher« nie wirklich gut war, meistens sogar schlechter als die Gegenwart. Es ist ein abstrakter Wahn.
Wir sind schlicht Heuchler, wenn wir uns im Sessel vor dem Fernseher zurücklehnen und die Politiker in den Talkshows beschimpfen, verachten, von ihnen enttäuscht werden. Denn tatsächlich benehmen wir uns dabei genau wie sie. Das ist eine Haltung, die ich nur zu gut kenne.
Wenn Visionen Veränderungen bedeuten, dann muss man als Politiker anders agieren, um den Glauben an Visionen nicht zu enttäuschen. Man muss mit Erwartungen brechen. Darauf aber ist das demokratische Parteiensystem nicht angelegt. Um Visionen in der Demokratie durchsetzen zu können, muss man sich widersprüchlich verhalten. Man muss auf Abweichung setzen, auf den Bruch von Erwartungen, in der Hoffnung, dass sie mehrheitsfähig werden. Letztlich bedeutet das, dass man von Menschen, die sich engagieren, fordert, dass sie alles auf eine Karte setzen müssen, ohne Netz und doppelten Boden agieren. Damit sie den Mut dazu aufbringen und behalten, wäre Vertrauen und Bereitschaft für Veränderung hilfreich. So gesehen ist Visionslosigkeit ein demokratisches Problem und ein Widerspruch: Individualität und Eigensinn müssen mehrheitsfähig werden. Die Stärke der Demokratie erklärt die Schwäche von Visionen. Aber um die Demokratie stark zu halten, brauchen wir immer wieder visionäre, begeisternde, aufrührende Politik und Politiker. Der Widerspruch bleibt. Das Beste, was wir tun können, ist, ihn lustvoll zu bejahen.
Letztlich rührt die Enttäuschung der Menschen von der Politik nicht von den Politikern. Und alle, die das behaupten, wollen in Wahrheit nur verhindern, dass die wirklichen Gründe für die Unzufriedenheit benannt werden. Denn diese würden bedeuten, dass sich etwas ändern muss. In Wahrheit rührt die politische Enttäuschung daher, dass die Gesellschaft weiterentwickelt ist und andere Probleme hat,
als unsere Regierungen sie zu lösen versuchen. Die Enttäuschung über die Politik, sie ist politisch. Und eben deshalb lässt sie sich ändern.
Aldi und Verdi
Wer kennt das nicht: Politische Forderung und eigenes Verhalten, Wollen und Wirklichkeit stimmen nicht überein. Wir wissen, dass Flugzeuge schädlich für das Klima sind und fliegen dennoch in den Urlaub. Wir wollen keine Blumen, die in Kolumbien mit unglaublichem Pestizidein- satz gezüchtet wurden und kaufen trotzdem den erstbesten Blumenstrauß zum Valentinstag. Wir lesen in der Tageszeitung von vergifteten Flüssen in Indien, in die das Gerbwasser der Schuhindustrie abgepumpt wird und vergessen es, wenn wir die Sandale im Geschäft in der Hand halten. Die Arbeitsbedingungen bei den großen Discountern sind bekannt und dass die Löhne dort zum Leben nicht reichen, dennoch kaufen wir dort ein. Ja, es kaufen auch die dort ein, die selbst keinen Mindestlohn erhalten und sich eigentlich mit ihren Kollegen und Kolleginnen an der Kasse solidarisieren müssten oder die in Gewerkschaften aktiv sind. Verdi und Aldi - morgens für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren, abends beim Discounter einkaufen _ Sind wir alle der Heuchelei überführt? Und soll man daraus nicht die Konsequenz ziehen, keine Vorsätze zu fassen, von denen man weiß, dass man sie nicht halten kann?
Das wäre voreilig.
Der Widerspruch ist zugegeben. Dass daraus politische Resignation folgen muss, nicht. Als Konsument verhalten wir uns anders denn als Bürger. Als Konsument schielen wir aufs Sonderangebot, das wir als Bürger gar nicht produziert haben wollen. Gäbe es morgen eine Volksabstimmung und die Frage lautete: »Wollen Sie, dass nur noch Jeans in Deutschland verkauft werden, die nicht von Kindern unter Umgehung der sozialen Standards produziert wurden, auch wenn diese dann teurer wären?« Ich bin sicher, das Ergebnis läge fast bei 100 Prozent. Und trotzdem kaufen wir anders ein. Das ist auch wenig überraschend, denn meistens richten wir unser Handeln auf Kurzsichtigkeit aus. Wer, der noch nicht 60 ist, ist wirklich beunruhigt über schlechte Rentenprognosen? Bei wem läuten schon die Alarmglocken, wenn die Erderwärmung anhand von Prognosen bis ins Jahr 2100 dargestellt wird. Das ist alles weit weg und wichtiger erscheint es, im Alltag genug Geld für einen Kinobesuch zu haben. Oder wir nehmen entgegen des ökologischen Vorsatzes dann doch das Auto, weil die Bahn so teuer ist oder man so lange auf den Anschluss warten muss. Das tun wir nicht, weil wir schlechte Menschen sind, sondern einfach weil Tage vollgestopft mit Terminen sind, Geld knapp und Freizeit kostbar ist. Die Folgerung kann aber nicht sein, politische Ziele aufzugeben, sondern, wenn wir halbwegs unseren Idealen entsprechen wollen, häufiger die Entscheidungssituation des Bürgers herzustellen. Und das bedeutet, dass wir Fragen so formulieren müssen, dass wir Antworten mit Entscheidungsalternativen schaffen, die eine Abwägung verschiedener Möglichkeiten, Langfristigkeit und Fairness richtig erscheinen lassen.
Es ist in Mode gekommen, den »Konsument als Bürger« zu bezeichnen und auf die Macht des Verbrauchers hinzuweisen. Tatsächlich ist der Verbraucher, wenn er denn seine Macht politisch nutzt, bereits Bürger. Und nur allzu oft wird unter der wohlfeilen Rede vom mündigen Verbraucher versucht, genau diese Bürger-Haltung auszuhebeln. Wenn ein Joghurtproduzent für sein Produkt, das voller Zucker und Geschmacksverstärker steckt, damit wirbt, dass er Krankheiten abwehrt, wenn ein Zuckerdrink als Durstlöscher bezeichnet wird, wenn die Computer-Industrie-Werbung immer mehr an Kinder adressiert wird und ihnen immer neue Prothesen des Spiels andreht, um die Unmittelbarkeit von Spielen zu zerstören, dann sind das Versuche, uns unserer Mündigkeit als Bürger zu berauben.
Die ist ein Mechanismus, ein Trick. Durch eine direkte moralische Haftung des Verbrauchers wird die politische Dimension der Verantwortung ausgeblendet. Die Ansprache ist auf das Subjekt gerichtet, auf seine Privatheit. Selbst die Produkte sprechen einen an: »Du darfst!«, »Nimm 2!«, »Merci!«. So mächtig die Macht des Verbrauchers ist, sie lädt eben auch zum Missbrauch und zur Manipulation ein. Teilhabe und gesellschaftlicher Stand definieren sich nicht mehr über Fragen politischen, kulturellen oder sozialen Engagements, sondern über Umfang und Formen des Konsums. Der Bürger wird zum Konsument und die Werbewirtschaft ist seine Regierung. Das soll nicht verächtlich klingen, im Gegenteil: Weil sie eine politisch andere Meinung hatte und woanders herkam, ist es der Linken, jedenfalls der postmaterialistischen, nicht gelungen, die Mehrheit anzusprechen, geschweige denn mitzunehmen.
Wie erreicht man das Gegenteil? Wie setzt man Anreize, dass Menschen sich gegen die Billigkeit des Atomstroms und für die Langfristigkeit von fair gehandelten Produkten entscheiden?
Nimmt man die Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie ernst, dann geht das nur, wenn sie ihre Kaufentscheidung direkt mit einem Nutzen für ihr Leben verbinden können. Wie schafft man also ein kreatives und verantwortungsvolles Bürgertum?
Die Kraft der Idee
Sich für sich selbst zu entscheiden, ist stets die leichteste Übung. Und Politik, die nur darauf zielt, den Egoismus ihrer Wähler zu befrieden, ist die einfachste und eben deshalb die kläglichste. Nun bin ich vielleicht ungerecht, wenn ich die komplizierten Abläufe, die zu Entscheidungen von Parteien oder Parlamenten führen, so harsch abkanzle. Aber zu ungerecht doch auch wieder nicht. Denn letztlich versuchen Parteien den Wettbewerb zwischen sich zu entscheiden, indem sie neue Wähler gewinnen oder alte halten. Und deshalb wird im Verteilungskampf knapper Kassen kurzfristig und einseitig entschieden.
Im Jahre 2009 wurden die Renten um das Doppelte gegenüber der gesetzlichen Planung erhöht. Das war einerseits bitter nötig, weil die Renten im unteren Bereich schon lange kaum noch ausreichend waren, andererseits roch es nach Wahlgeschenk. Eine systematische Rentenform, die der sich klar am Horizont abzeichnenden Altersarmut vorbeugt, wird nicht angepackt. Die Riesterrente, eingeführt, um das Rentensystem mit einer dritten, Kapital gedeckten Säule zu stabilisieren, wird für alle Menschen mit niedrigen Einzahlungen kaum zu Entlastungen führen, weil sie auf die Grundsicherung angerechnet wird und so »arme« Rentenempfänger von ihr gar nicht profitieren. Aber da mit der Einführung des Riester-Rentenbeitrags der gesetzliche Beitrag um 4 Prozent abgesenkt wurde, wurde das Sozialsystem zusätzlich geschwächt. Wie immer man sich zu dem Problem drohender Altersarmut verhält, ignorieren sollte man es nicht! Politiker in Deutschland tun das aber, weil sie befürchten, dass allein die Debatte Menschen verschrecken würde.
Ein anderes Problem sind die Pensionen der Beamten. Anders als bei der gesetzlichen Altersrente, die von der Beitragshöhe und der Beitragszeit abhängig ist, richtet sich die Höhe der Pensionen nach dem letzten Gehalt der Beamten. Auf den Staat rollt eine riesige Pensionslawine zu - und trotzdem reformieren wir das Beamtenrecht nicht, bzw. beschränken es auf die Kernelemente staatlichen Dienstes, weil die Politik Sorge hat, Privilegierte zu verprellen. Und ökologische Verantwortungslosigkeit ist sowieso gang und gäbe.
Wenn Menschen aber gegen ihre kurzfristigen Interessen handeln und sich stattdessen nachhaltig verhalten sollen, braucht es mehr als nur moralisierende Reden oder Bücher. Es braucht einen Anreiz, es muss cool sein, sich zu engagieren. Und das coolste und im Materialismus der letzten Jahrzehnte völlig unterschätzte Moment ist die Kraft der Idee und der dahinter verborgende Idealismus. Ein Idealismus, der nicht abstrakt und tumb daherkommt, sondern der die eigene Welt und das eigene Handeln mit einem weitsichtigen Engagement verknüpft. Die Suche der Menschen, die Orientierungslosigkeit der Gesellschaft schreit förmlich danach. Die viel beschworenen »Werte« des Bürgertums laufen völlig ins Leere und höhlen eine gesellschaftliche Debatte nur immer mehr aus. Und diese Werte sind nicht allein Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - ihr Traditionsbestand umfasst das ganze Spektrum der Werte-Vokabeln (Leistung, Wohlstand, Aufstieg, Anerkennung Aber sie alle reflektieren nicht mehr die Verhältnisse der Gegenwart. Statt Gleichheit Geiz, statt Freiheit Wohlstand, statt Solidarität Eigensinn, statt Leistung Bezahlung, statt Anerkennung Sozialneid. Diese Interpretation von Werten können wir uns getrost schenken.
Aber auch die emanzipatorischen, linken Kräfte bleiben unter ihren Möglichkeiten und geben keine Richtung vor, schaffen es nicht, die verschiedenen Politikbereiche zu fokussieren und ihren Zusammenhang zu erläutern. Sie ste- hen einem solchen Anlauf selbst im Weg, weil sie sich stets in vornehmer Zurückhaltung üben, wenn es um ein positives Verhältnis zur Gesellschaft geht. Es ist aber unmöglich, für ein besseres Allgemeinwesen zu streiten, wenn man es - zumindest emotional - ablehnt.
Als Adressat und Verbindung zwischen den Gegensätzen, zwischen »Liberalität« und »Paternalismus«, zwischen »verantwortungsvoll« und »kreativ«, zwischen »Bürger« und »Konsument« braucht man ein positives Gesellschaftsverständnis. Man braucht es, um eine sinnstiftende, politische Erzählung zu schaffen, die Zutrauen und Zuversicht gibt, dass Veränderungen gut sind und es sich lohnt, für sie zu streiten. Man braucht eine Erzählung, die auf Veränderung setzt, auf Gerechtigkeit und Internationalität. Dieses Engagement nenne ich einen »linken Patriotismus«.
Ich schreibe das in vollem Bewusstsein, dass ich Widerspruch provozieren werde. Patriotismus, Vaterlandsliebe also, fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht. Und Salbadereien, wie die im »Liebesbrief an Deutschland« des Bild-Kolumnisten Franz Josef Wagner machen es nicht leichter, über Patriotismus nachzudenken. Wagner schreibt: »Was ist geschehen, dass wir unser Land ohne Scham wieder lieben? Ich glaube, es begann mit dem Papst. Es war das Großereignis, wo [sic!] ein Deutscher aus der Generation Hitler zum Stellvertreter Gottes gewählt wurde [...] Ich denke, dass wir alle Heimweh haben, pures Heimweh [...] Wir haben nun ein Land, das so schön ist, dass einem die Tränen kommen. Ich sehe Bauernhöfe mit Gänsen und Hühnern. Und ich sehe die Bäuerin, die eingelegte Gurken verkauft [... ] Die Menschen falten friedlich die Hände. Es sind Hände, die gearbeitet haben, die in nassen Schlamm gegriffen haben, verfaulte Blätter aussortierten. Ich liebe diese Hände, weil sie Deutschland sind.« Der Journalist Jörg Lau schob in »Eurozine« den coolen Kommentar nach: »Betende Hände im nassen Schlamm - Wagners Liebesbrief liest sich wie Eichendorff auf Kokain.« Lau erkennt im Nachdenken über Deutschland eine »aktuelle Selbstverständigungsdebatte«. Genau darum geht es.
War es noch in den rot-grünen Jahren schick, sich in die patriotische Gleichgültigkeit zurückzuziehen, ziehe ich jetzt einen anderen Schluss. Ja, ich bin der Meinung, dass es genau jenes unaufgeklärte Verhältnis zum Gemeinwohl war, das das rot-grüne Projekt so schnell müde und nach Verrat hat aussehen lassen. Wenn man Dinge ändern will, muss man sie zuerst als Problem annehmen. Um eine Fahrradkette wieder auf die Zahnräder zu setzen, muss man sich die Hände schmutzig machen. Das Risiko der Empörung nehme ich in Kauf. Wenn wir nicht auch das nächste Jahrzehnt zu Nulljahren machen wollen, dann muss die gesellschaftliche Debatte nun raus aus ihren Löchern. Dass Deutschlands Geschichte über weite Strecken eine der Barbarei war, heißt nicht, dass man sich darum nicht zu scheren braucht, dass Zivilcourage und Einsatz nichts nützen. Erstens würde man damit das Land nur erneut den Barbaren ausliefern, zweitens würde man eine völkische Denkweise übernehmen, nämlich dass es so etwas wie den Geist einer Nation gibt. Intellektuelle Redlichkeit zwingt zum Bemühen um einen linken Patriotismus.
Die ganze trotzige Haltung des Protests und der Konfrontation ist heute eher ein Hindernis zu echtem Engagement. »Die Eigentlichen«, schrieb der Anarchist Hugo Ball einmal, »das sind die, die gar nichts tun.« Und er hat recht. Sich neue Debatten und Fragen zuzumuten und zu stellen, das bedeutet immer auch, die eigene Position kritisch zu hinterfragen. Man verlässt den Ausgangspunkt, das Eigene, wird uneigentlich. Jede neue Debatte verändert die politische Programmatik und irritiert deshalb. Aber »eigentlich« zu bleiben, um den Preis jetzt nichts zu tun, dafür allen zu zeigen, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ist keine Option.
Begeisterung für Politik, Gemeinwohl, Engagement ist notwendig. Sie ist geradezu zwingende Voraussetzung für Veränderung. Begeisterung aber braucht einen Sinn, ein Ideal, braucht andere Menschen und die Hoffnung auf eine Verbesserung. Ideale ohne Menschen sind nur leere Ideen. Letzteres beschreibt den Zustand der politischen Kultur in Deutschland. Wir wurschteln uns so durch, reformieren so vor uns hin, aber nur kurzsichtig, ohne langfristige Ideen und konsequente Ideale.
Die Hoffnung vieler war, dass das rot-grüne Regierungsbündnis das emanzipatorische Projekt werden würde, nach dem wir uns gesehnt hatten. Und dann kam Gerhard Schröders visionsloser Regierungsstil gefolgt von Merkels Nüchternheit. Visionen aber sind nicht nur eine Dreingabe zur Unterhaltung. Sie sind eine Antwort auf die Sinnsuche, die unser Leben ausmacht. Nicht nur zu leben, sondern sich zu engagieren, nicht nur Mittel zu benutzen oder Zweck zu sein, sondern Selbstbestimmung zu haben, die die Routine hinter sich lässt, das ist die Entgegnung auf einen stumpfen Materialismus, dessen Funktionärs-Fachjargon uns so zum Hals raushängt. Wenn Politik wie eine Endlosschleife von Weihnachtsansprachen klingt, dann verkommt sie zu ihrem eigenen Echo. Als ich Landesvorsitzender wurde, im Landtagswahlkampf 2004, druckte meine Partei auf ihre Plakate »Unter den gegebenen Parteien sind die Grünen die beste aller denkbaren Alternativen«. Als ich das las - da waren die Plakate schon gedruckt - überlegte ich ernsthaft, den Job wieder zu schmeißen. Dieser Relativismus, dieser Zynismus, den wollte ich nicht. Und ich bin mir sicher, CDU, SPD oder FDP-Mitglieder leiden daran genauso.